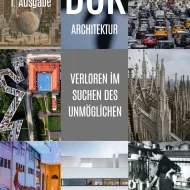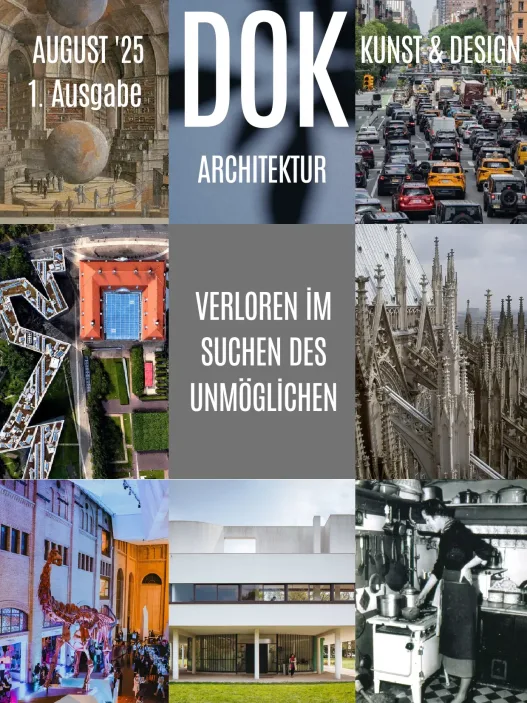Der modulare und vorgefertigte Bau geht über Schnelligkeit und Kosteneffizienz hinaus und legt den Schwerpunkt auf langfristige Anpassungsfähigkeit und Wiederverwendung. Unter Verwendung standardisierter Rastersysteme und lösbarer, trockener Verbindungen (Bolzen, Schrauben, Clips) können modulare Komponenten demontiert und in neuen Konfigurationen oder an neuen Orten wieder zusammengebaut werden, was ihre Lebensdauer über verschiedene Gebäudetypen hinweg verlängert.

Eine kürzlich in Hongkong durchgeführte Studie hat gezeigt, dass temporäre modulare Einheiten (die häufig als Kurzzeitunterkünfte verwendet werden) bei ordnungsgemäßem Rückbau bis zu 50 Jahre lang ihren Wert behalten und in Katastrophengebiete oder Gebiete mit Wohnungsmangel transportiert werden können, anstatt auf einer Deponie zu landen. Dies erfordert die Entwicklung von Modulen mit universellen Schnittstellen (Ausrichtung der strukturellen Raster, standardisierte Modulmaße) und anpassungsfähiger MEP-Infrastruktur – Plug-and-Play-Anschlüsse für Mechanik, Elektrik und Sanitärtechnik, die leicht entfernt und wieder angeschlossen werden können.
BoKlok, Schweden: Die BoKlok-Häuser von IKEA und Skanska sind ein Beispiel für ein modulares System, das sowohl auf Effizienz als auch auf Kreislaufwirtschaft ausgelegt ist. BoKlok baut seine hölzernen Wohnmodule in der Fabrik mit weniger als 1 % Materialabfall und legt Wert auf ein zerlegbares Design, so dass die Häuser auseinandergenommen und ihre Komponenten recycelt oder wiederverwendet werden können, anstatt sie abzureißen.

Mehr als 12.000 BoKlok-Häuser in Skandinavien verwenden ein maßgeschneidertes Massenraster, d. h., die Module können kombiniert werden, um verschiedene Grundrisse zu schaffen, ohne dass die Standardisierung verloren geht. Dieser Ansatz ermöglicht es, Komponenten (Wände, Bodenkassetten usw.) zu ersetzen oder zu verlegen, wenn sich die Bedürfnisse ändern, was die Lebensdauer des Gebäudes verlängert. Die Fundamente von BoKlok werden mit hoher Präzision für die Platzierung der Module konstruiert, und alle Wohnblöcke werden vor Ort mit einem Kran in Position gebracht – dieser Prozess kann für eine spätere Verlegung der Module umgekehrt werden.
BLOX, Kopenhagen: Das BLOX-Gebäude von OMA in Kopenhagen – obwohl ein dauerhaftes Gebäude mit gemischter Nutzung – zeigt, wie modulares Denken die Anpassungsfähigkeit erhöhen kann. Der Entwurf besteht im Wesentlichen aus rechteckigen Volumina (oder „Blöcken“) auf einem regelmäßigen strukturellen Raster, wodurch eine „akrobatische Mischung von Nutzungen“ innerhalb geometrischer Module entsteht. BLOX beherbergt Büros, Wohnungen, ein Museum, ein Co-Working Center und mehr, die in einer vertikalen Reihe ähnlich großer Einheiten angeordnet sind.

Dieser Ansatz mit gestapelten Blöcken bot OMA nicht nur die Flexibilität, eine stark befahrene Straße zu überbrücken und Stadtgebiete miteinander zu verbinden, sondern zeigte auch, wie künftige Änderungen durch Neuaufteilung oder Funktionsänderungen zwischen den modularen Gondeln möglich sind. Obwohl die Komponenten von BLOX nicht für den Transport außerhalb des Standorts konzipiert waren, wurden die blockartigen Fassadenpaneele und die Innenaufteilung mit Blick auf Vorfertigung und potenzielle Neukonfiguration entwickelt (viele Innenelemente wurden auf reversible Weise zusammengesetzt). Das Projekt zeigt, dass selbst ikonische Architektur ein modulares Raster nutzen kann, um eine räumliche Anpassungsfähigkeit im Laufe der Zeit zu ermöglichen – ein Prinzip, das in anderen Zusammenhängen die Wiederverwendung von Modulen in neuen Projekten ermöglichen könnte.
WikiHouse (Open-Source-System): Das eher experimentelle WikiHouse-System bietet Open-Source-Entwürfe für modulare Gebäude, die jeder mit CNC-geschnittenem Holz bauen kann. Anpassungsfähigkeit und Wiederverwendung sind hier die Schlüsselprinzipien: WikiHouse-Blöcke (Paneele und strukturelle Komponenten) werden mit ineinandergreifenden Verbindungen geschnitten und mit minimalem Leim oder Nassbearbeitung zusammengesetzt. Ein einzelnes WikiHouse kann erweitert, modifiziert oder komplett demontiert werden; fast alle Teile können demontiert oder aus ihren Gehäusen entfernt und dann in einer neuen Konfiguration wiederverwendet werden.

Die Erfinder des Systems beschreiben es als „Lego für echte Gebäude“. Standardisierte Sperrholzlatten, Platten und Falzverbindungen ermöglichen es, die Strukturen ohne Beschädigung zu trennen. Das bedeutet, dass ein heute gebautes Haus mit WikiHouse Jahre später wieder abgebaut und in seine Einzelteile zerlegt werden kann oder direkt zu einer anderen Struktur umgebaut werden kann. Durch die offene Veröffentlichung von Entwürfen ermöglicht WikiHouse einer globalen Gemeinschaft auch die Iteration und Anpassung von Modulen an verschiedene Standortkontexte – und zeigt, wie sich modulare Architektur entwickeln und reisen kann. In der Praxis wird dies durch einen rigorosen Baukastenansatz erreicht: Nichts ist dauerhaft eingebettet, und selbst die Verkleidung, die Isolierung und die Fenster werden aus kompatiblen Optionen ausgewählt (jedes Standardfenster oder jede Verkleidung kann verwendet werden, solange sie in die modularen Abmessungen passen).

Modular Circular Pavilion (Studio ACTE, 2021) – entworfen als Bausatz aus Teilen, die leicht demontiert und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden können. Der Holzrahmen und die Polycarbonat-Paneele sind ohne Klebstoffe miteinander verschraubt, was einen kleinen Ansatz für modulare Wiederverwendbarkeit demonstriert.
In all diesen Fällen gibt es mehrere gemeinsame Entwurfsstrategien: die Verwendung haltbarer, aber lösbarer Materialien (z. B. Holz, Stahl), die durch reversible Verbindungen miteinander verbunden sind; die Planung von strukturellen Rastern und Modulgrößen, die in verschiedene Grundrisse eingepasst werden können; und die Einbeziehung „zukunftssicherer“ Servicekerne oder -kanäle, so dass Sanitäranlagen und Verkabelung ohne Demontage des Moduls neu konfiguriert werden können. Indem sie in erster Linie für die Anpassungsfähigkeit entwerfen, können Architekten sicherstellen, dass ein vorgefertigtes Klassenzimmer oder eine Wohnung von heute morgen Teil einer Klinik oder eines größeren Wohnblocks werden kann. Das Ergebnis ist eine Architektur, die Komponenten als langfristige Vermögenswerte behandelt und ihren Wert über die Lebensdauer eines einzelnen Gebäudes hinaus bewahrt.

Gebäude von Anfang an für den Rückbau entwerfen
„Design for Disassembly“ (DfD) ist ein nachhaltiger Designansatz, bei dem Gebäude wie riesige Puzzles entworfen werden – sie sollen am Ende ihrer Lebensdauer elegant demontiert werden, damit die Komponenten wiederverwendet werden können. Es ist von entscheidender Bedeutung, DfD-Strategien bereits in der frühesten Entwurfsphase einzubeziehen: Sie wirken sich auf alles aus, von der Wahl des Tragwerkssystems (Vorzug für verschraubte Stahl- oder Holzständerwerke gegenüber monolithischem Betonguss) bis hin zur Art der Befestigung von Oberflächen und Fassaden (Verwendung von Schrauben, Klammern oder Haken anstelle von Kleb- und Dichtstoffen). Das Ziel ist die Reversibilität: Jede Schicht des Gebäudes muss so zusammengesetzt sein, dass sie in umgekehrter Reihenfolge mit minimalen Schäden entfernt werden kann.
Wichtige Konstruktionsstrategien, die den Rückbau und die Wiederverwendung unterstützen, sind:
Trockenbau und umkehrbare Verbindungen:Bevorzugen Sie trockene Verbindungstechniken – mechanische Verbindungselemente (Schrauben, Muttern, Klammern, Klemmen) und ineinandergreifende Systeme – gegenüber nassen Verfahren wie Schweißen, Mörtel oder Klebstoffen. Die Verwendung von Stahlträgern mit verschraubten Endplattenverbindungen würde es beispielsweise ermöglichen, eine Struktur stückweise zu demontieren, während geschweißte Verbindungen oder Ortbeton geschnitten oder zerstört werden müssten.
Schichtweise Detaillierung und Zugang: Gebäude bestehen aus mehreren Schichten (Struktur, Verkleidung, Haustechnik, Innenräume usw.), und die DfD-Konstruktion stellt sicher, dass jede Schicht getrennt werden kann, ohne die anderen zu stören. Dies bedeutet oft, dass zugängliche Befestigungen vorgesehen werden müssen – z. B. Fassadenplatten, die an einem Rahmen befestigt sind und durch Lösen einiger Schrauben entfernt werden können, oder Bodenplatten, die demontiert werden können, um die darunter liegenden mechanischen Systeme zu erreichen. Eine klare Kennzeichnung der einzelnen Komponenten ist ebenfalls hilfreich. Einige DfD-Praktiker verwenden farblich gekennzeichnete oder beschriftete Verbindungen, um künftige Teams anzuleiten (z. B. indem sie Demontageanweisungen auf Strukturelemente sprühen oder überall standardisierte Schrauben verwenden). Der Gedanke dahinter ist, dass jeder, der über einfache Werkzeuge und das Bau-„Handbuch“ verfügt, das Gebäude in logischen Schritten auseinandernehmen kann. Stewart Brands Konzept des Schneidens von Schichten (Trennung von Struktur, Verkleidung, Versorgungsleitungen usw.) wird häufig herangezogen: Durch die Gestaltung von Schnittstellen zwischen den Schichten (z. B. Klammern, mit denen Kanäle an Trägern befestigt werden, statt starrer Verbindungen) kann jedes System unabhängig aktualisiert oder entfernt werden.
Materialpässe und Kennzeichnung: Eine neue Strategie besteht darin, digitale Kennzeichnungen (oder sogar physische Etiketten) in die Komponenten zu integrieren, um die zukünftige Wiederverwendung zu erleichtern. Im Prototyp des Circular Building in London von 2016 ist jedes Bauteil mit einem QR-Code gekennzeichnet, der mit einem digitalen Materialpass verknüpft ist.

Diese Art der Dokumentation bedeutet, dass Bauteile am Ende ihrer Lebensdauer identifiziert werden können und ihre Eigenschaften sofort bekannt sind – was die Wahrscheinlichkeit, dass sie zertifiziert und in neuen Projekten wiederverwendet werden, erheblich erhöht. Das Team von Circular Building stellte fest, dass sich die Prioritäten bei der Planung und dem Bau von Gebäuden im Hinblick auf diese neue Entwicklung grundlegend geändert haben und eine engere Zusammenarbeit mit Lieferanten und Bauunternehmen erforderlich ist. Die Einbeziehung der Zulieferer war von entscheidender Bedeutung: Viele Komponenten wurden unter der Bedingung geliefert, dass sie zurückgegeben werden können. Tatsächlich wurde das Circular Building zusammengebaut, einige Zeit ausgestellt, dann erfolgreich demontiert und seine Teile an die Hersteller zurückgegeben oder anderweitig wiederverwendet. Dieser Fall beweist, dass ein Gebäude eine Materialbank sein kann und nicht ein Abfallerzeuger.
Vermeiden Sie zusammengesetzte und verklebte Materialien: Eine weitere DfD-Richtlinie besteht darin, die irreversible Verbindung verschiedener Materialien zu vermeiden. Anstatt beispielsweise Teppichboden auf eine Bodenplatte zu kleben (was sowohl Teppich als auch Beton unwiederbringlich macht), sollten lose verlegte oder mechanisch befestigte Oberflächen verwendet werden. Strukturell sollten anstelle von schwer zu trennenden Verbundkonstruktionen (wie z. B. Stahl-Beton-Verbundkonstruktionen oder geklebte CLT-Paneele) trennbare Systeme gewählt werden: z. B. ein Stahl- oder Holzrahmen mit demontierbaren Ausfachungsplatten. Wenn Verbundwerkstoffe verwendet werden, sollten diese als Module konzipiert sein , die als Ganzes wiederverwendet werden können. Ein gutes Beispiel sind vorgefertigte Betonbodenplatten, die nicht im Strang mit dem Rahmen gegossen, sondern als einzelne Platten hergestellt und mit der Struktur verschraubt werden. Im Bürogebäude Matrix One von MVRDV in Amsterdam werden sogar die Betondecken ohne feste Nassfugen hergestellt – sie können im Gegensatz zu typischen Ortbetondecken verschraubt und demontiert werden. Diese bewusste Zersetzung der Elemente sorgt dafür, dass mehr als 90 Prozent der Materialien von Matrix One in Zukunft wiederverwendet werden können.

Kreisförmiger Pavillon (ReUse Italien / Studio ACTE): Der in Rotterdam errichtete Circular Pavilion (siehe oben) ist ein DfD-Vorzeigeprojekt in kleinem Maßstab. Es wurden wiederverwendete Materialien (alte Turnhallenböden als Holzdielen, gebrauchte Acrylplatten von einem Bauernhof, wiederverwendete Ziegel und Stampflehm) verwendet, die in einem flexiblen Holzrahmen mit Gewindestangen und Bolzen zusammengefügt wurden. Jedes Material hatte bereits ein Leben und wurde hier zu neuem Leben erweckt, und, was besonders wichtig ist, jedes kann wieder entfernt werden. Das Designteam beschrieb das Gebäude als einen „organisierten Baukasten“, bei dem jedes Element und Detail sichtbar und zugänglich ist. Der temporäre Charakter des Pavillons ist für den Nutzer unsichtbar – er sieht aus und funktioniert wie eine permanente Gartenstruktur – kann aber leicht abgebaut werden. Dieses Projekt unterstreicht die Bedeutung des praktischen Prototyping: Jede Verbindung wurde anhand von Modellen getestet, um sicherzustellen, dass sie gebaut werden kann, und das Design wurde an die verfügbaren wiederverwendeten Materialien angepasst. Das Ergebnis ist ein poetisches kleines Gebäude, das beweist, dass Demontierbarkeit nicht zu Lasten von Robustheit oder Schönheit gehen muss. Tatsächlich verleihen die sichtbaren Schraubverbindungen und die gemischten und aufeinander abgestimmten Materialien dem Gebäude einen einzigartigen Charakter und zelebrieren die Erzählung der Wiederverwendung.

Rotor Deconstruction (Belgien): Das belgische Kollektiv Rotor ist ein Pionier auf dem Gebiet des Rückbaus, indem es wiederverwendbare Komponenten aus alten Gebäuden extrahiert. Die Arbeit von Rotor (über seine Tochtergesellschaft Rotor DC) unterstreicht, warum Design für den Rückbau unerlässlich ist: Sie demontieren sorgfältig die Innenräume und Strukturen von Gebäuden, die abgerissen werden sollen, und bergen alles, vom Parkettboden über Beleuchtungskörper bis zum Baustahl. Dabei stoßen sie oft auf Bauteile, die nie hätten ans Tageslicht kommen dürfen – geklebte Böden, die zerbröseln, oder monolithisch gegossene Betonbalken ohne Hebepunkte. Rotor befürwortet ein „wiederverwendungsfreundliches“ Design, was bedeutet, dass die Architekten von heute Gebäude so planen sollten, dass die Materialien nach 30 oder 50 Jahren noch intakt „geerntet“ werden können. Die Praxis von Rotor DC, mit wiederverwerteten Materialien zu handeln (sie betreiben ein Lager für gebrauchte Bauelemente), hat sogar die belgische Politik beeinflusst, die den Rückbau dem Abriss vorzieht. Die Lektion: Wenn ein Gebäude für den Rückbau konzipiert ist, können Unternehmen wie Rotor DC die wertvollen Teile mit minimalem Aufwand zurücknehmen und sie für neue Projekte wiederverwenden. Umgekehrt werden ohne DfD selbst hochwertige Materialien zu Schutt, weil sie zu schwer zu sortieren sind. In den Worten von Rotor : „Wir demontieren, verarbeiten und tauschen geborgene Bauelemente aus„, d. h. wir holen vergangene Strukturen zurück, obwohl dies viel einfacher wäre, wenn diese Strukturen mit einem Plan für das Ende ihrer Nutzungsdauer entworfen worden wären.

ICEhouse von William McDonough (Davos): Ein berühmtes Beispiel für Design für die Demontage ist McDonoughs ICEhouse™ (Innovation for the Circular Economy House), ein Pavillon auf dem Weltwirtschaftsforum, der wiederholt zusammen- und auseinandergebaut wurde. Das ICEhouse verwendet das patentierte WonderFrame™-System aus Aluminium-Strukturelementen, die ohne Schweißen ineinandergreifen. Die Wände bestehen aus Polycarbonatplatten, die in den Rahmen eingesetzt werden, und die Isolierung erfolgt durch abnehmbare Aerogel-Abdeckungen. McDonough beschreibt das ICEhouse poetisch als „eine Struktur, die dazu bestimmt ist, abgebaut und wieder aufgebaut zu werden… so flüchtig wie Eis: eine Woche lang hier, dann schmilzt es weg und taucht woanders wieder auf“.


In der Praxis werden jedes Jahr in Davos die gleichen Teile auf- und wieder abgebaut. Alle Komponenten sind technische Nährstoffe – Aluminium, Polymere -, die entweder unbegrenzt wiederverwendet oder zu gegebener Zeit in hoher Qualität recycelt werden können. Es werden keine giftigen Dichtstoffe oder Verbundstoffe verwendet, so dass nichts den Recyclingstrom verunreinigt. Das Projekt zeigt, wie eine sorgfältige Konstruktion (spezielle Knotenverbindungen, leichte Teile) es ermöglicht, ein ganzes Gebäude sowohl schnell zu montieren als auch vollständig zu demontieren. Es handelt sich um ein kreisförmiges Konstruktionsmodell: Nach jedem Gebrauch werden die Materialien verpackt und sind für den nächsten Einsatz bereit, oder wenn ein Teil beschädigt ist, kann es eingeschmolzen und wiederhergestellt werden. Das ICEhouse beweist, dass ein demontierbares Gebäude auch unter rauen alpinen Bedingungen funktionieren und Veranstaltungen beherbergen kann, und sendet die klare Botschaft, dass temporäre Architektur kein Wegwerfprodukt sein muss.
Die Einbeziehung von DfD von Anfang an erfordert ein Umdenken bei den Planungs- und Bauteams. Architekten müssen die Verbindungen nicht nur im Hinblick auf die Stabilität, sondern auch auf den künftigen Zugang detailliert ausarbeiten; Ingenieure müssen die Bauteile möglicherweise leicht überdimensionieren, um Schraubverbindungen zu ermöglichen (z. B. gegen die Dauerfestigkeit einer Schweißnaht); Bauunternehmer müssen die Konstruktion so anordnen, dass sie rückgängig gemacht werden kann. Es gibt auch eine Schulungskomponente – Arbeiter und künftige Nutzer müssen wissen, wie sie das Gebäude auseinandernehmen können. Hier helfen Dokumentationen und Materialpässe, aber auch einfache Konstruktionsmaßnahmen wie das Freilassen von Verbindungspunkten oder intuitive Bedienung. Richtig gemacht, ist das Ergebnis ein Gebäude mit einer Quelle für hochwertige Materialien und nicht die Kosten für den Abriss am Ende seines Lebenszyklus. Ein Planungsteam drückte es so aus : „Wir betrachten Gebäude als organisierte Materiallager… so dass in der Zukunft jeder in der Lage sein wird, alles von ihnen zu sammeln, ohne an Wert zu verlieren“. Diese Philosophie, unterstützt durch konkrete Strategien wie die oben beschriebene, steht im Mittelpunkt von Design for Dismantling.
Wiederverwendung von geborgenen Elementen: Authentizität und technische Zwänge
Die Einbeziehung von geborgenen architektonischen Elementen, von jahrhundertealten Holzbalken bis hin zu früher verwendeten Fenstern oder dekorativen Paneelen, kann den Charakter und das Nachhaltigkeitsprofil eines neuen Projekts erheblich bereichern. Dieser Ansatz, der oft als adaptive Wiederverwendung oder Upcycling-Architektur bezeichnet wird, bringt eine greifbare Geschichte in das zeitgenössische Design ein. Eine verwitterte Tür oder ein Fassadenpaneel aus Kupfer mit Patina erzählt Geschichten und Handwerkskunst, die neuen Materialien oft fehlen. Die Wiederverwendung von Bauteilen birgt jedoch auch Herausforderungen: Es muss sichergestellt werden, dass sie den modernen Vorschriften entsprechen (Brandschutz, Tragfähigkeit, Energieisolierung), sie müssen an neue Dimensionen oder Systeme angepasst werden, und die Beteiligten müssen von ihrer Zuverlässigkeit überzeugt werden. Zeitgenössische Projekte, die sich erfolgreich der Rettung verschrieben haben, zeigen ein Gleichgewicht zwischen poetischer Authentizität und rigoroser technischer Integration.
Räumliche Qualität und Authentizität: Designer stellen häufig fest, dass wiederverwendete Elemente den Räumen einen „Geist“ oder eine Authentizität verleihen, die mit völlig neuen Materialien nur schwer zu erreichen ist. Variationen in der Textur und offensichtliche Zeichen des Alters (Rostspuren, abgenutzte Kanten) können eine vielschichtige Ästhetik schaffen – einen Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Verwendung von aufgearbeiteten Holzbalken in einem Innenraum zum Beispiel bewahrt diese Bäume nicht nur vor der Mülldeponie, sondern ihr gealtertes Aussehen kann Wärme verleihen und die Geschichte der Entwicklung des Gebäudes erzählen. In Einzelhandels- oder öffentlichen Projekten werden diese Elemente oft zum Gesprächsstoff. Es gibt auch ein Ethos der Kontinuität: Besonders wenn Teile der bestehenden Strukturen eines Standorts wiederverwendet werden, fühlen sich die Bewohner mit dem verbunden, was vorher da war. Die Architekten sollten diese Elemente jedoch bewusst gestalten und sie nicht als nachträgliche Idee behandeln.
Eine gängige Strategie ist die Inszenierung von Kontrasten: alt und neu nebeneinander. Die freiliegende Ziegelwand eines abgerissenen Gebäudes kann neben neuen Gipskartonplatten zu einer Inneneinrichtung werden – eine solche Schichtung wurde bei Projekten wie den öffentlichen Gebäuden von RAAMWERK in Belgien zelebriert, wo die „fröhliche Wiederverwendung bestehender Bausubstanz“ als wichtiger Bestandteil der Gestaltung einer dauerhaften Umgebung angesehen wird. Im Jugendzentrum Lichtervelde von RAAMWERK wurden beispielsweise Elemente einer älteren Struktur auf dem Gelände beibehalten und integriert, so dass eine Patchwork-Ansicht entstand, die dem neuen Zentrum sofort eine lebendige Qualität verleiht und das sterile Gefühl eines völlig neuen Gebäudes vermeidet.


Technische Beschränkungen und Lösungen: Bei der Wiederverwendung von Türen, Fenstern, Bauelementen oder Verkleidungsmaterialien müssen sich Architekten zwischen Bauvorschriften und Leistungsstandards bewegen. Sicherheit ist oberstes Gebot: Die Festigkeit eines alten Stahlträgers muss überprüft und möglicherweise neu ausgelegt werden, um den aktuellen Belastungen gerecht zu werden; Holzbretter müssen möglicherweise behandelt werden, um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen. Ein häufiges Hindernis ist die Wärmedämmung und die Energieleistung.
So entsprechen beispielsweise historische Fenster nicht den heutigen thermischen Anforderungen. Zu den Lösungen gehören die Verstärkung mit Doppelverglasung (sofern der Rahmen dies zulässt) oder die Verwendung als Innenverglasung oder dekorative Elemente anstelle von Außenverkleidungen. Beim Prototyp des Circular Building wählte das Team Komponenten aus, die den Vorschriften entsprechen, oder arbeitete mit den Herstellern zusammen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten – jedes wiederverwendete Teil hatte eine bekannte Leistung oder wurde getestet. Außerdem fügten sie jedem Material QR-codierte Daten hinzu, damit künftige Nutzer seine Eigenschaften kennen.
Für Strukturelemente gibt es zunehmend Leitlinien für die Zertifizierung von wiederverwendetem Stahl oder Beton. Einige europäische Normen erlauben jetzt wiederverwendete Stahlprofile, wenn sie bestimmte Tests bestehen. Darüber hinaus können kreative Ansätze die Beschränkungen abmildern: Wenn eine geborgene Säule nicht stark genug ist, um schwere Lasten zu tragen, kann sie vielleicht auf eine nicht tragende Weise verwendet werden (als Gestaltungselement oder in einem niedrig belasteten Abschnitt des Gebäudes). Eine weitere Taktik ist die Überspezifizierung – verwenden Sie geborgene Elemente mit einer Sicherheitsmarge, um die Ingenieure zufrieden zu stellen.
Eine weitere technische Überlegung betrifft Passform und Toleranzen. Wiederverwendete Gegenstände weisen oft unterschiedliche Größen oder Zustände auf. Die Gestaltung erfordert Flexibilität – wenn beispielsweise 100 recycelte Türen in eine Fassade eingebaut werden sollen, kann es erforderlich sein, jede einzelne mit einem anpassbaren Rahmen zu versehen oder einige zuzuschneiden, um kleine Unterschiede auszugleichen. Der Designer kann diesen Umstand in eine Besonderheit verwandeln, indem er alte und neue Fliesen mischt oder gemusterte Layouts erstellt, die fehlende Fliesensätze aufnehmen. Diese kreativen Anpassungen können tatsächlich zu Design-Highlights werden und Räumen eine einzigartige Identität verleihen.
Building 111 von 6a Architects (Vereinigtes Königreich): Das Londoner Architekturbüro 6a Architects hat eine lange Tradition in der sensiblen Wiederverwendung, und Building 111 ist eines ihrer beispielhaften Projekte, bei dem sie Altes und Neues zusammenbringen (Building 111 ist ein Teil eines ehemaligen Kasernengeländes, das in Kunststudios umgewandelt wurde, um ein Beispiel zu geben). 6a hat die bestehende Backsteinstruktur (mit all ihren verwitterten Unvollkommenheiten) erhalten und dort, wo es nötig war, geschickt neue Ergänzungen vorgenommen.

Sie schufen auch eine Collage aus Materialien, indem sie Elemente wie Metalltreppen und Innentüren aus anderen Teilen des Geländes für das Gebäude 111 verwendeten. Die räumliche Qualität wird durch die Gegenüberstellung erhöht: eine alte Stahltür mit Farbschichten steht neben einer neu gestalteten Kiefernwand. Die 6a wählt bewusst aus, welche Mängel beibehalten und welche Leistungsmängel unauffällig korrigiert werden, um den Charakter zu bewahren (z. B. wird ein altes Fenster mit einer dünnen Sekundärverglasung versehen, um die Wärmedämmung zu verbessern, der Originalrahmen bleibt jedoch erhalten). Projekte wie diese unterstreichen einen grundlegenden Gedanken: Die adaptive Wiederverwendung fügt einem Gebäude Schichten der Zeit hinzu. Es geht nicht um eine Nachahmung, sondern um die Offenlegung der Lebensdauer von Materialien – ein Neubau ist nur das letzte Kapitel in einer fortlaufenden Geschichte.

Aus technischer Sicht besteht eine der größten Herausforderungen bei wiederverwendungsorientierten Projekten darin, Kunden und Regulierungsbehörden zu überzeugen. Oft ist eine zusätzliche Dokumentation erforderlich: Prüfung von Bergungsgut, Einholung von Sondergenehmigungen, wenn etwas noch nicht zertifiziert ist, und manchmal die Anwendung leistungsbezogener Normen (Nachweis der Gleichwertigkeit mit neuen Materialien). Ein typisches Problem ist der Brandschutz: Ältere Hölzer müssen unter Umständen intumeszierend beschichtet werden, um die Feuerwiderstandsklassen zu erfüllen, oder sie werden in unkritischen Bereichen (z. B. als nicht tragende Deckenbalken) belassen, um strenge Anforderungen zu umgehen. Feuchtigkeit und Haltbarkeit sind ebenfalls Faktoren – wenn Sie ein altes Material einer neuen Umgebung aussetzen, müssen Sie sicherstellen, dass es sich nicht weiter verschlechtert. Das könnte bedeuten, dass ein poröser alter Ziegel abgedichtet oder ein alter Balken mit einer im Inneren verborgenen Stahlplatte verstärkt wird.
Trotz dieser Hindernisse sind die ökologischen und kulturellen Vorteile erheblich. Die Wiederverwendung von Bauteilen kann den gebundenen Kohlenstoff eines Projekts erheblich reduzieren (da kein neues Material hergestellt wird) und die Abfallmenge verringern. Die Verwendung eines geborgenen Fassadensystems beispielsweise spart nicht nur die Herstellung neuer Fassadenverkleidungen, sondern verhindert auch, dass die alten weggeworfen werden. Kulturell gesehen wird dadurch auch die Auslöschung der lokalen Handwerkskunst verhindert. Viele wiederverwertete Produkte – verzierte Türen, historische Fliesen – sind handgefertigt oder aus Materialien hergestellt, die nicht mehr verfügbar sind; wenn sie im Umlauf bleiben, wird dieses Erbe bewahrt. Darüber hinaus hat der heutige Fokus auf die Kreislaufwirtschaft die Unterstützung erhöht: Kunden und Städte sehen den Wert darin, sich durch die Integration von Wiederverwertung als Pioniere der Kreislaufwirtschaft zu profilieren. Auszeichnungen für Projekte wie den neuen Hauptsitz der Triodos Bank (bei dem Materialien wiederverwendet und ein kreislauforientiertes Design angewandt wird) zeigen, dass diese Bemühungen in der Branche Anerkennung finden.
Die Gestaltung mit geretteten Elementen erfordert eine hybride Denkweise. Man muss sowohl Designer als auch Kurator sein: Man muss die richtigen Stücke auswählen, sie manchmal restaurieren und die neue Struktur um sie herum entwerfen. Dies ist ein kreativer Zwang, der zu einzigartigen Ergebnissen führen kann. Wie in einer Ausstellung flämischer Projekte festgestellt wurde, ist dieser „Collage“-Ansatz – historische Schichten und unvorhersehbare Kollisionen als endlose Energiequelle – zu einem berühmten Thema in der zeitgenössischen belgischen Architektur geworden. Wichtig ist, dass diese Kollisionen bewusst erfolgen und dass die alten Teile tatsächlich der neuen Funktion dienen (und nicht nur oberflächlich angebracht werden). Richtig gemacht, können die Bauvorschriften eingehalten werden, und das Ergebnis sind Räume von großer Tiefe und Authentizität, die auch eine ressourcenschonendere Bauweise vorleben.
Digitale Tools und Plattformen ermöglichen wiederverwendbare Architektur
Die digitale Technologie erweist sich als mächtiger Verbündeter auf dem Weg zu einer kreisförmigen und wiederverwendbaren Architektur. Von BIM-basierten Materialpässen bis hin zu KI-gestütztem Materialabgleich – neue Tools bewältigen die Komplexität der Nachverfolgung von Komponenten während ihres Lebenszyklus und erleichtern Architekten und Bauunternehmern die Wiederverwendung. Die Integration dieser Tools in reale Arbeitsabläufe ist noch in der Entwicklung, aber führende Projekte und Plattformen weisen auf eine Zukunft hin, in der jede Gebäudekomponente eine digitale Identität und Daten trägt, die ihre spätere Wiederverwendung erleichtern.
Gebäudedatenmodellierung (BIM) und Materialpässe: Mit moderner BIM-Software kann man nicht nur Pläne zeichnen, sondern auch Metadaten für jedes Objekt in einem Gebäudemodell einbetten. Diese Fähigkeit wird nun erweitert, um Materialpässe zu erstellen: digitale Aufzeichnungen aller Materialien und Produkte in einem Gebäude, einschließlich ihrer Eigenschaften, Herkunft und Demontageanweisungen. Plattformen wie Madaster dienen als cloudbasierte Materialbanken, in denen diese Pässe gespeichert werden. Beim Projekt des Hauptsitzes der Triodos Bank in den Niederlanden zum Beispiel wurde jedes Element des Gebäudes (bis hin zu Schrauben und Platten) während der Planung und des Baus in Madaster registriert. Die Architekten von RAU nennen ihren Ansatz „Gebäude als Materiallager“ – das Gebäude wurde so eingerichtet, dass in Zukunft jeder mit Hilfe eines digitalen Registers Materialien daraus sammeln kann. Die Plattform Madaster speichert den Namen jedes Materials, seine Menge und sogar, wo es sich im Gebäude befindet.

Für Triodos arbeiteten die BIM-Manager der Bauunternehmen zusammen, um alle IFC-Daten der Komponenten in Madaster hochzuladen, so dass der Kunde nach Fertigstellung des Gebäudes einen digitalen Zwilling der Materialien erhält. Auf diese Weise kann die Triodos Bank (oder jeder künftige Eigentümer) genau sehen, was sie hat, und die Wiederverwendung oder das Recycling am Ende der Nutzungsdauer mit echten Daten planen. An einigen Orten werden Materialpässe auch obligatorisch – die niederländische Regierung beispielsweise macht sie für neue Projekte ab einer bestimmten Größe zur Pflicht, um die Industrie zu Zielen der Kreislaufwirtschaft zu bewegen. In der Praxis kann ein Pass zum Beispiel aufzeigen, dass ein Gebäude 50 Tonnen Stahlträger der Klasse X, 200 Quadratmeter Glas des Typs Y usw. enthält, die bei der Renovierung oder dem Abriss des Gebäudes den Märkten zur Verfügung gestellt werden können.
Lebenszyklusbewertung (LCA) und Zirkularitätsmetriken: Digitale Planungswerkzeuge ermöglichen es Architekten, die Auswirkungen von Wiederverwendung und Neubau zu simulieren und zu vergleichen. One Click LCA, eine weit verbreitete Software für Kohlenstoff- und Lebenszyklusanalysen, hat ein Building Circularity-Modul eingeführt. Mit diesem Modul können die Benutzer den prozentualen Anteil an recycelten oder wiederverwendeten Materialien eingeben und Szenarien für das Ende des Lebenszyklus (Wiederverwendung, Recycling, Deponie usw.) für jedes Material auswählen. Die Software liefert dann einen „Zirkularitätswert“ für das Gebäude. und quantifizieren die Kohlenstoffeinsparungen, die sich aus der Wiederverwendung von Komponenten ergeben.
So kann ein Architekt beispielsweise ein Szenario modellieren, bei dem 30 % der Fassade aus wiederverwendeten Paneelen besteht, und sehen, wie sich dadurch der Kreislaufgedanke verbessert und der verkörperte Kohlenstoff im Vergleich zu einem komplett neuen Szenario reduziert. Wenn Sie „Wiederverwendung“ als End-of-Life-Option für ein Material in One Click LCA auswählen, kontrollieren Sie implizit, ob Ihr Design dies zulässt. Als Teil der Anleitung schlägt das Tool sogar Dinge vor wie die Verwendung von lösbaren Befestigungen anstelle von Klebstoffen “ und die Gestaltung von Materialien, die sich an zukünftige Veränderungen anpassen lassen „. Die Software integriert diese Empfehlungen und verknüpft sie mit Konstruktionsprinzipien für die Demontage. Solche LCA-Tools werden zunehmend in frühen Entwurfsphasen eingesetzt, um Ziele für die Kreislaufwirtschaft festzulegen und die Einhaltung von Zertifizierungen für umweltfreundliches Bauen zu dokumentieren, die Wiederverwendung belohnen.
Künstliche Intelligenz, maschinelles Sehen und Materiallager: Ein besonders spannendes Gebiet ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Sehen zur Identifizierung und Katalogisierung von Materialien, die für eine Wiederverwendung geeignet sind. Stellen Sie sich vor, Sie richten einen 3D-Scanner (mit LiDAR oder Photogrammetrie) auf ein Gebäude, das abgerissen werden soll; KI-Algorithmen könnten Türen, Balken, Fassadenplatten usw. erkennen und automatisch ein digitales Inventar der wiederverwendbaren Komponenten erstellen. Forschungsprototypen tun genau das.
In einem kürzlich erschienenen Nature-Artikel wurde ein„D5 Digital Circular Workflow“ beschrieben, bei dem Schritt 1 die Erkennung ist: Einsatz von maschinellem Lernen und Computer Vision auf städtischen Daten, um Gebäude und Elemente zu identifizieren, die für eine Wiederverwendung geeignet sind.
- Erkennung: Nutzung städtischer Daten in Kombination mit Algorithmen des maschinellen Lernens (ML) und der Computer Vision (CV), um Bereiche zu identifizieren, die für die Wiederverwendung von Materialien geeignet sind, und diese Materialien in Gebäudedatenmodellierungssysteme (BIM) einzubinden.
- Rückbau: Umfassende Katalogisierung von Materialien mittels Reality Capture, Scannen nach BIM und CV, um Robotik und erweiterte Realität (XR) für die Demontage zu ermöglichen.
- Vertrieb: Erstellung von digitalen Produktpässen (DPPs) zur effizienten Verfolgung, Rückverfolgung und zum Handel mit Materialien vom Abriss bis zur neuen Baustelle.
- Design: Anwendung generativer künstlicher Intelligenz (KI) und computergestützter Designalgorithmen zur Erstellung und Abstimmung von Designs mit wiederverwerteten Materialien.
- Anwendung: Verwendung von subtraktiver und additiver Fertigung, um maßgeschneiderte, wiederverwertete Elemente zu integrieren und sie mit XR-Techniken zu neuen Strukturen zusammenzusetzen.
Plattformen und Marktplätze: Neben proprietären Tools entstehen auch offene Plattformen. Harvest Map (Oogstkaart), entwickelt von Superuse Studios, ist ein Online-Tool, das lokal verfügbare Abfälle und überschüssige Materialien aufzeigt. Architekten und Bauherren können die Karte nach Materialart und Standort durchsuchen – und so zum Beispiel herausfinden, dass eine nahe gelegene Fabrik jetzt Holzpaletten liefert oder dass ein Abbruchgelände am anderen Ende der Stadt Stahlträger anbietet.
Superuse Studios hat diesen Ansatz bei Projekten wie der Villa Welpeloo angewandt, wo sie Kabeltrommeln und Maschinenteile für den Bau eines ganzen Hauses beschafften. Harvest Map ist im Wesentlichen ein Crowdsourced Repository und zeigt den Wert von Geodaten bei der Wiederverwendung – die Nähe ist wichtig, da der Transport schwerer Materialien über eine zu große Entfernung die Umweltvorteile zunichte machen kann. „Durch die Visualisierung von ‚urbanen Minen‘ auf einer Karte werden Designer dazu ermutigt, den Weg zu einem Schrottplatz oder einer Fabrikhalle durch die Bestellung von neuem Material zu ersetzen.

Es gibt auch formellere Plattformen für den Materialaustausch: In Europa listet das Opalis-Verzeichnis professionelle Schrotthändler und -bestände auf, und Städte wie Amsterdam haben Online-Zentren eingerichtet, in denen Bauunternehmer vor dem Kauf neuer Materialien prüfen müssen, ob wiederverwendete Materialien verfügbar sind. In einigen nordischen Ländern sind die Datenbanken mit dem öffentlichen Beschaffungswesen verknüpft – ein staatliches Projekt kann beispielsweise dazu verpflichtet sein, einen bestimmten Prozentsatz der Materialien von diesen Wiederverwendungsplattformen zu beziehen.
Integration in Arbeitsabläufe: Eine der Herausforderungen besteht darin, diese digitalen Werkzeuge in der schnelllebigen Baubranche nutzbar zu machen. Die BIM-basierte Materialverfolgung wird immer einfacher, da Firmen Werkzeuge wie Autodesk Revit oder Bentley-Systeme mit Plug-ins für Materialpässe einsetzen. Einige Architekturbüros haben begonnen, „Kreislaufspezialisten “ zu beschäftigen, die sicherstellen, dass BIM-Modelle mit den notwendigen Daten für eine spätere Wiederverwendung gefüllt werden (z. B. Kennzeichnung, ob ein Material recycelbar ist oder ob ein Bauteil für die Demontage vorgesehen ist). In der Praxis könnte ein Unternehmen eine Regel aufstellen: Jedes Objekt im Modell muss einen Füllparameter für „Wiederverwendungspotenzial“ und „Material-ID in der Datenbank“ haben. Dies bedeutet zwar einen gewissen Mehraufwand bei der Planung, zahlt sich aber aus, wenn Gebäudemanager oder Abbrucharbeiter die Daten Jahrzehnte später nutzen.
Auch Bauunternehmer beginnen, beim Abriss digitale Werkzeuge einzusetzen. Vor dem Abriss eines Gebäudes können sie einen schnellen 3D-Scan erstellen und mithilfe von Software wertvolle Gegenstände identifizieren. Einige wenden sich sogar Anwendungen im Auktionsstil zu, bei denen eine Person zum Beispiel schreiben kann: „Wir haben 100 Deckenleuchten des Modells X in drei Monaten verfügbar“, und Interessenten können diese dann beanspruchen. Initiativen in Europa haben damit experimentiert, Komponenten vor Ort mit RFID-Chips oder QR-Codes zu versehen und sie mit Materialpässen zu verknüpfen – so dass eine Tür beim Ausbau gescannt werden kann und einem Käufer sofort alle Informationen (Brandschutzklasse, Größe usw.) bekannt sind.
Madaster und runde Gebäude: Die (aus den Niederlanden stammende) Madaster-Plattform wird oft mit einem „Kataster“ von Materialien verglichen – einem Eigentumsnachweis, allerdings für Bauteile. Eine bemerkenswerte Anwendung war die Renovierung des Edge Amsterdam West, wo Tausende von Teilen erfasst wurden und ein Materialpass für das gesamte Gebäude erstellt wurde. Die Plattform ist nicht nur ein Inventar, sondern berechnet auch den Restwert von Materialien im Laufe der Zeit, was einen wirtschaftlichen Anreiz für Gebäudeeigentümer darstellt (Ihr Gebäude ist nicht nur ein abschreibungsfähiges Vermögen, sondern eine Materialbank, die ihren Wert behält).

Der oben beschriebene Hauptsitz der Triodos Bank war eines der ersten Gebäude, bei dem Madaster während der Planung und des Baus vollständig eingesetzt wurde. Es war eine Lernkurve für die Auftragnehmer, BIM-Informationen von allen Unterauftragnehmern in eine zentrale Materialdatenbank zu übertragen, aber jetzt wird dieser Prozess rationalisiert. Madaster und ähnliche Tools lassen sich in BIM integrieren, so dass zum Beispiel einer Fassadenplatte, sobald sie modelliert ist, eine Produkt-ID aus einer Bibliothek zugewiesen und ihre eventuelle Wiederverwendbarkeit dokumentiert werden kann. Die Hoffnung ist, dass in Zukunft, wenn jemand das Gebäude umgestalten oder abreißen will, er mit einem einzigen Klick einen vollständigen Materialbericht herunterladen kann. Der Gedanke der Kreislaufwirtschaft wird Teil der alltäglichen Praxis: Architekten denken darüber nach, wie sie den „Kreislaufwert“ maximieren können, Bauunternehmer erwägen den Wiederverkauf von Bauteilen, und sogar Eigentümer können Materialien leasen (einige Geschäftsmodelle schlagen vor, dass Hersteller das Eigentum an Bauteilen behalten und die „Dienstleistung“ des Produkts leasen und es am Ende der Lebensdauer zurücknehmen – die digitale Verfolgung macht dies möglich).
Superuse Studios (Digital + Design): Die Superuse Studios (ehemals 2012Architecten) in den Niederlanden sind Vorreiter bei der Kombination von digitalen Werkzeugen und wiederverwendbarem Design. Sie haben die bereits erwähnte Harvest Map entwickelt und setzen auch computergestützte Designtechniken ein, um zufällig geborgene Teile zusammenzustellen. Bei einem Projekt hatten sie einen Stapel ausrangierter blauer Stahlträger unterschiedlicher Länge. Mit Hilfe einer Software für parametrisches Design (Grasshopper für Rhino) erstellten sie einen Algorithmus zur Erstellung von Pavillonformen, wobei sie nur diese Träger in voller Länge (ohne Beschnitt) verwendeten und eine Form fanden, die in das verfügbare Material passte.
Dies ist ein einfaches Beispiel dafür, wie Algorithmen die Wiederverwendung optimieren können: Anstatt den Schrott so zuzuschneiden, dass er in ein vorgefertigtes Design passt, dehnt sich das Design so aus, dass es in den Schrott passt. Dies ist eine Umkehrung, die durch Berechnungen ermöglicht wird: Bei einem Eingabedatensatz von Bauteilen kann der Computer Tausende von Designoptionen durchgehen, um ein Design zu finden, bei dem alles effizient genutzt wird.
Dieser Ansatz wurde im D5-Workflow aufgegriffen – generative künstliche Intelligenz, die Entwürfe mit wiederverwerteten Materialien abgleicht. Dieser Ansatz ist zwar noch ein Nischenbereich, wird aber wahrscheinlich wachsen, vor allem, weil der Druck der Nachhaltigkeit Architekten dazu zwingt, mit dem zu planen, „was bereits vorhanden ist“, und nicht mit dem, „was neu bestellt werden muss“.
Künstliche Intelligenz für den Materialabgleich: Künftig könnte KI auch die Identifizierung von Materialien vereinfachen, die in bestehenden Gebäuden wiederverwendet werden können. Autodesk Research arbeitet zum Beispiel an einer KI, die Gebäudescans analysieren kann, um Elemente wie Nägel oder Platten hinter Trockenbauwänden zu erkennen. Kombiniert man dies mit Datenbanken für Materialeigenschaften, kann man sich einen KI-Assistenten vorstellen, der dem Architekten während einer Renovierung sagt: „Die Deckenbalken, die Sie entfernen wollen, sind in gutem Zustand: „Die Deckenbalken, die Sie entfernen wollen, sind altes Kiefernholz in gutem Zustand – sie können als Bodenbelag neu gegossen werden, hier sind einige Gestaltungsmöglichkeiten.“ Tatsächlich kann die künstliche Intelligenz das „Matching “ von Angebot und Nachfrage übernehmen, was derzeit eine Herausforderung darstellt.
Durch das Sammeln von Daten von vielen Abbruchbaustellen und vielen neuen Projekten kann ein System Übereinstimmungen vorhersagen und vorschlagen: „Projekt A braucht 50 Marmorplatten; Projekt B wird in 6 Monaten 50 ähnliche Platten produzieren, Sie können sie verbinden!„). Der Nature-Artikel stellt fest, dass es schwierig, aber entscheidend ist, das Ende der Lebensdauer eines Gebäudes mit dem Beginn der Lebensdauer eines anderen in Einklang zu bringen. Digitale Plattformen können diese zeitliche Lücke überbrücken, indem sie Speicherlösungen anbieten – vielleicht virtuelle „Materialkonten“, auf denen Komponenten gespeichert werden, während sie auf eine neue Verwendung warten, und künstliche Intelligenz dafür sorgt, dass sie nicht vergessen werden.
Die Integration ist in realen Arbeitsabläufen entscheidend. Diese Werkzeuge sollten mit bekannter Software (CAD, Projektmanagement-Tools) verbunden werden, so dass die Verwendung eines geborgenen Trägers genauso einfach ist wie die Verwendung eines neuen Trägers im Konstruktionsmodell. Wir sehen die ersten Schritte: Revit verfügt jetzt über Plugins für die Kreislaufwirtschaft; die EC3-Kohlenstoffdatenbank enthält Optionen zur Darstellung wiederverwendeter Materialien. Städte investieren in diese Plattformen – so könnte beispielsweise die Stadtsanierungsbehörde von Singapur Scanning und Datenbanken einsetzen, um den Abriss von Sozialwohnungen zu verwalten und Teile in neuen Wohnungen wiederzuverwenden.
Die Digitalisierung verwandelt einen früher sehr analogen Ad-hoc-Prozess (Auffinden und Wiederverwendung alter Gebäudeteile) in eine datengesteuerte, systematische Praxis. Dies erhöht das Vertrauen (Kenntnis der genauen Spezifikationen eines wiederverwendeten Teils), verringert die Reibungsverluste bei der Suche (Online-Marktplätze und -Landkarten) und optimiert das Design (durch computergestützte Werkzeuge und künstliche Intelligenz). All diese Entwicklungen bedeuten, dass Architekten die Wiederverwendung leichter einbeziehen können, ohne das Budget oder den Zeitplan zu sprengen. Einem Bericht zufolge kann die digitale Transformation das zirkuläre Bauen erleichtern und dazu beitragen, die Fragmentierung in der Branche zu überwinden, die die Wiederverwendung von Materialien behindert, indem sie die Effizienz erhöht. Wir bewegen uns auf ein Szenario zu, in dem jedes Material nachverfolgt wird, jedes Gebäude einen Rückbauplan hat und jeder Designer einen digitalen Assistenten für die Kreislaufbauweise hat – eine spannende Kombination aus Technologie und Nachhaltigkeit.

Das Innere von Matrix One in Amsterdam – ein Bürogebäude aus dem Jahr 2023, das für eine vollständige Demontage konzipiert ist. Nahezu jedes Bauteil (Struktur, Fassade, Ausstattung) in diesem sechsstöckigen Gebäude ist abnehmbar und für eine spätere Wiederverwendung dokumentiert. In Zusammenarbeit mit Madaster erstellte das MVRDV-Team digitale Materialpässe für mehr als 120.000 Komponenten und schätzte, dass 90 % der Materialien nach der Nutzung des Gebäudes wiederverwendet und weiterverkauft werden könnten. Solche Projekte zeigen, wie BIM-Modelle und Datenbanken kombiniert werden können, um eine groß angelegte Materialverfolgung in der Praxis zu ermöglichen.
Bildung, Politik und Codes: Auf dem Weg zu einer Kultur der Wiederverwendbarkeit
Um einen systemischen Wandel in der Art und Weise zu erreichen, wie wir Gebäude entwerfen, instand halten und abreißen, bedarf es mehr als nur projektbezogener Innovationen; es sind auch Änderungen in der Ausbildung, der öffentlichen Politik und den Bauvorschriften erforderlich. In den letzten Jahren hat sich in der akademischen Welt und bei den Regierungen die Erkenntnis durchgesetzt , dass die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in den Lehrplänen für Architektur verankert, durch politische Anreize gefördert und in Vorschriften kodifiziert werden müssen, damit sie zur neuen Norm werden und nicht die Ausnahme bleiben.
Architekturausbildung: Universitäten und Designschulen beginnen damit, die nächste Generation von Architekten von Anfang an für die Wiederverwendbarkeit zu sensibilisieren. Pionierprogramme wie das „Circular Studio“ an der TU Delft in den Niederlanden binden Studenten in Designprojekte ein, bei denen die Umwandlung des kulturellen Erbes, die Wiederverwendung von Materialien und niedrige Emissionen im Vordergrund stehen.

In diesem Studio sollen die Studenten ein altes Gebäude umgestalten, indem sie es nicht abreißen, sondern kreativ wiederverwenden und durch wiederverwendete Komponenten ergänzen – und dabei den eingesparten Kohlenstoff berechnen. In ähnlicher Weise sind an der TU Berlin und anderen Institutionen Studios mit Titeln wie „REsourceful Architecture“ oder „Adaptive Reuse Lab“ entstanden. Diese Kurse fördern eine Denkweise, die bestehende Gebäude als Steinbrüche betrachtet, und vermitteln praktische Fertigkeiten: Durchführung eines Material-Audits eines Gebäudes, Beschaffung von Abbruchmaterial und Beschreibung von Verbindungen für den Rückbau. Bei Wettbewerben für Studenten werden zunehmend Kriterien der Kreislaufwirtschaft berücksichtigt. So werden beispielsweise beim Solar Decathlon (einem internationalen Studentenwettbewerb für nachhaltigen Wohnungsbau) Punkte für die Wiederverwendung von Materialresten und den Rückbau vergeben.

Das Ergebnis ist eine junge Generation von Architekten, die Schrottplätze genauso kreativ sehen wie Materialkataloge und die es gewohnt sind, digitale Werkzeuge zu nutzen, um vom ersten Tag an Kreislaufstrategien zu entwickeln. Dieser Bildungswandel ist von entscheidender Bedeutung: Er normalisiert die Wiederverwendbarkeit und fördert eine Kultur, in der das Vorschlagen einer Lösung aus zweiter Hand als ebenso innovativ (wenn nicht sogar innovativer) angesehen wird wie das Erfinden einer neuen Form. In einem akademischen Papier heißt es, dass die Einführung solcher Studios die Designausbildung in eine „ganzheitliche Lernerfahrung“ verwandelt hat, die sich auf die Kreislaufwirtschaft im Kontext des historischen Erbes und neuer Gebäude konzentriert. Zusätzlich zu den Designstudios lehren einige Ingenieur- und Baumanagementprogramme Rückbautechniken und Kreislaufwirtschaft, um sicherzustellen, dass alle zukünftigen Bauteams wissenskompatibel sind.
Politische Anreize und öffentliches Beschaffungswesen: Regierungen auf städtischer, regionaler und nationaler Ebene setzen zunehmend politische Maßnahmen ein, um wiederverwendbare Architektur zu fördern (oder vorzuschreiben). Ein herausragendes Beispiel ist die Region Brüssel-Hauptstadt in Belgien, die ein ehrgeiziges Programm zur Kreislaufwirtschaft verabschiedet hat. Von öffentlichen Projekten in Brüssel wird nun erwartet, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen: Der Regionalplan sieht vor, dass „die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangeht “ und öffentliche Aufträge als Hebel nutzt, um Kreislauflösungen zu fordern. Dies hat zu folgenden Anforderungen geführt: Bevor ein öffentliches Gebäude abgerissen wird, muss ein detailliertes Materialinventar erstellt und wiederverwendbare Elemente auf dem Markt angeboten werden; neue öffentliche Gebäude müssen einen Mindestanteil an recycelten oder wiederverwendeten Inhalten enthalten; und bei der Vergabe von Aufträgen werden Kreislaufmethoden gewichtet. Brüssel führt auch den Projektaufruf „Be Circular“ durch, der Zuschüsse und Anerkennungen für bestimmte Projekte bietet, die Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaft demonstrieren. Solche Anreize können das wirtschaftliche Gleichgewicht verschieben und einen wiederverwendungsorientierten Ansatz finanziell attraktiver machen.

Städte wie Amsterdam haben sich konkrete Ziele gesetzt: Bis 2030 soll die Verwendung von Neumaterialien halbiert und bis 2050 ein vollständig kreislauforientierter Ansatz verfolgt werden. Die Amsterdamer Umsetzungspläne sehen unter anderem vor, dass neue Gebäude einen Materialpass haben müssen und dass Bauabfälle drastisch reduziert werden. Außerdem wurden Materialdepots erprobt – temporäre Lagerzentren für wiederverwendbare Komponenten -, da man erkannt hat, dass zeitliche Unstimmigkeiten logistische Lösungen erfordern (eine Studie schlug mehrere lokale Zentren in der Stadt als optimales System für die Wiederverwendungslogistik vor).
Die Politik kann auch in Form von Steuern und Gutschriften erfolgen. In einigen Ländern wird eine Ermäßigung der Mehrwertsteuer (Steuer) auf wiederverwertete Materialien und sogar auf Bauleistungen, einschließlich Rückbau, erwogen. Dies würde die Kostenwettbewerbsfähigkeit der Wiederverwendung direkt erhöhen. Hohe Deponiesteuern zwingen Bauträger bereits indirekt dazu, Alternativen zur Deponierung zu finden (so ist es beispielsweise im Vereinigten Königreich aufgrund der Deponiesteuer in vielen Fällen billiger, Gegenstände zu bergen als zu deponieren). Ein weiteres Instrument sind Dichteboni oder Genehmigungsvorteile für Projekte, bei denen Strukturen erhalten oder Materialien wiederverwendet werden, nach der Logik des öffentlichen Nutzens durch Abfallvermeidung.
Bauvorschriften und Normen: Einer der schwierigsten Bereiche ist die Anpassung der Bauvorschriften, um die Wiederverwendung zu erleichtern. Traditionell sind die Vorschriften auf neue Materialien ausgerichtet oder gelten nur, wenn alte Materialien an Ort und Stelle belassen werden. Für echte Kreislaufsysteme müssen die Vorschriften die Neuzertifizierung von wiederverwendeten Komponenten ermöglichen. Hier sind Fortschritte zu verzeichnen: Frankreich zum Beispiel hat seine Bauvorschriften aktualisiert, um die Wiederverwendung von Baustahl und einigen anderen Elementen zu erleichtern (und Normen für die Bewertung gebrauchter Komponenten festzulegen). In ähnlicher Weise arbeitet die EU an dem Konzept der „Level(s) „, einem Rahmen von Kreislaufwirtschaftsindikatoren für Gebäude, die in Zukunft Teil der Harmonisierung von Vorschriften werden könnten. Einige spezifische Änderungen, die helfen könnten, sind: die Zulassung alternativer Wege zur Einhaltung der Vorschriften (wenn z. B. ein wiederverwendeter Balken kein Originalzertifikat des Herstellers hat, könnte die Beurteilung und Prüfung durch einen Ingenieur ausreichen, um seine Unbedenklichkeit zu bescheinigen); die Zulassung leistungsbezogener Brandschutzlösungen für altes Holz (z. B. die Zulassung eines intumeszierenden Anstrichs, wenn es nicht mit Trockenbauwänden abgedeckt werden kann); und die Aufnahme von Definitionen für „wiederverwendetes Material“ in die Gesetzessprache, damit diese Materialien nicht automatisch als minderwertig oder Abfall behandelt werden.
Zertifizierungssysteme wie LEED, BREEAM und andere haben damit begonnen, die Wiederverwendung zu belohnen – LEED vergibt Punkte sowohl für die adaptive Wiederverwendung ganzer Gebäude als auch für die Verwendung von wiederverwerteten Materialien (mit Schwellenwerten, die auf den Kosten oder dem Volumen basieren). Dies ermutigt die Projektteams, frühzeitig über die Wiederverwendung von Materialien nachzudenken. Da diese Zertifizierungen häufig Einfluss auf Vorschriften oder zumindest auf die gängige Praxis haben, fordern sie indirekt auch die Industrie heraus.
Öffentlich-private Initiativen und Wissensaustausch: Viele Städte und Länder haben Wissensplattformen eingerichtet, um die Wiederverwendbarkeit zu fördern. Die Plattform für zirkuläre Gebäude in Amsterdam beispielsweise bringt Kommunen, Architekten und Bauunternehmer zusammen, um bewährte Verfahren auszutauschen und standardisierte Leitlinien für zirkuläres Bauen zu entwickeln. Durch solche Foren kann beispielsweise eine erfolgreiche Methode, die in einem Projekt angewandt wird (z. B. die effektive Kennzeichnung aller Gebäudekomponenten auf Zeichnungen für den späteren Rückbau), zu einer empfohlenen Praxis für alle Projekte in dieser Stadt werden. Pilotprojekte sind ebenfalls wichtig: Regierungen finanzieren oft Pilotbauten, die Kreislaufmethoden testen und klare Berichte erstellen. Das Projekt Buildings as Material Bank (BAMB) (ein EU-Forschungsprogramm im Rahmen von Horizont 2020) hat dies in vielen Ländern getan und bis 2019 Prototypgebäude und Leitlinien für recyclingfähiges Design, Materialpässe usw. geliefert. Diese Ergebnisse fließen nun in die EU-Politik und lokale Vorschriften ein.
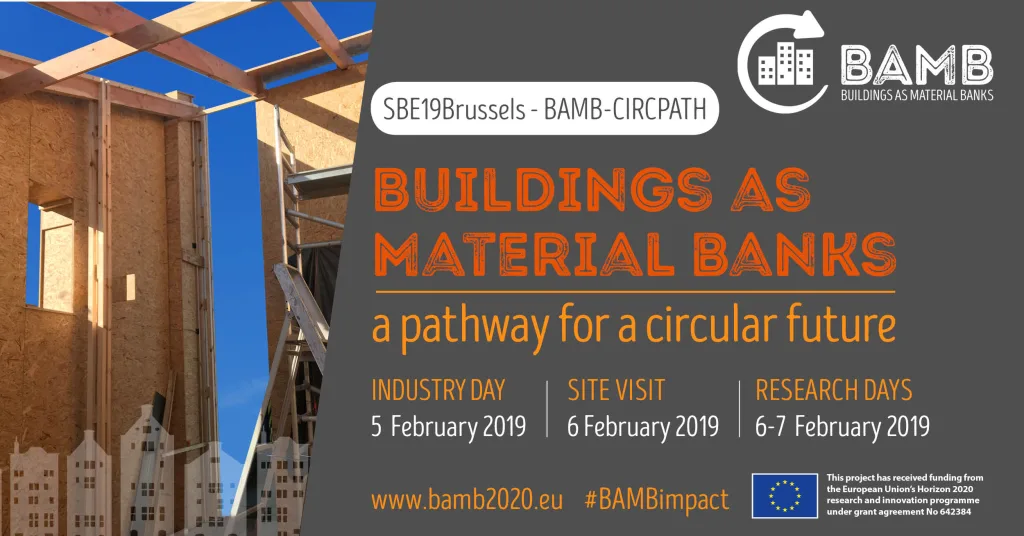
Industrie und kultureller Wandel: Politik und Bildung schaffen den Rahmen, aber die Beteiligung der Industrie ist entscheidend. Es ist ein vielversprechender Trend, dass große Baufirmen und Bauträger die Kreislaufwirtschaft als Teil ihrer Marke und Strategie annehmen. Der niederländische Bauträger EDGE Technologies hat sich öffentlich dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass alle seine Projekte über Materialpässe und Kreislaufprinzipien verfügen. Wenn große Akteure eine Vorreiterrolle übernehmen, entsteht Druck in der Lieferkette – Hersteller beginnen, Rücknahmesysteme anzubieten, Zulieferer führen Optionen für die Rücknahme ein usw. Es gibt auch einen aufstrebenden Markt für die Vermietung von Gebäudekomponenten (Beleuchtung als Dienstleistung, Bodenbeläge als Dienstleistung), der mit der Wiederverwendung vereinbar ist, da der Anbieter einen Anreiz zur Rücknahme und Aufarbeitung hat. Die Eigentümer von Gebäuden, insbesondere von öffentlichen Gebäuden, werden dazu erzogen, den Rückbau als Dienstleistung zu betrachten (anstelle eines Abrisses) – Städte wie Portland (USA) haben den Rückbau (stückweiser Rückbau) für alte Gebäude verbindlich vorgeschrieben, wodurch eine Rückbauindustrie entstanden ist.
Gesellschaftliche und kulturelle Wahrnehmung: Aus kultureller Sicht verändert sich die öffentliche Wahrnehmung von wiederverwendeten Materialien mit der zunehmenden Sichtbarkeit von Kreislaufkonzepten. Während die Verwendung gebrauchter Materialien früher Bedenken hinsichtlich ihrer „gebrauchten“ Qualität hervorrief, sehen viele dies heute als Ehrenzeichen oder zumindest als clevere Innovation an. Architekturmagazine und -ausstellungen würdigen zunehmend Projekte, die wiederverwertete Elemente enthalten, und machen aus dem, was früher nur am Rande vorkam, ein erstrebenswertes Ziel. Die Architekturbiennale von Venedig widmete sich dem Thema Kreislaufwirtschaft, und Preise wie der Neue Europäische Bauhaus-Preis enthalten Kategorien für adaptive Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaft, was diesen Ansätzen Prestige verleiht.
Ausbildung von Handwerkern und Fachleuten: Die Ausbildung ist nicht nur für Architekten. Auch Handwerker (Bauunternehmer, Rückbauexperten, Materialprüfer) müssen für dieses Paradigma geschult werden. Einige Regionen haben damit begonnen, Zertifizierungsprogramme für den Rückbau anzubieten, in denen die Arbeiter lernen, wie man Gebäude sorgfältig demontiert (welche Schrauben zuerst entfernt werden müssen, wie man Materialien so zuschneidet, dass sie geborgen und nicht weggeworfen werden, usw.). Digitale Kompetenz ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung – die Verwendung der in Kapitel 4 beschriebenen Materialverfolgungsinstrumente und Datenbanken erfordert neue Fähigkeiten im Feld und im Büro. Daher entwickeln einige fortschrittliche Bauunternehmen die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter, um beispielsweise Materialien während der Bauphase zu kennzeichnen und zu erfassen und sich mit den Designern über Wiederverwendungspläne abzustimmen.
Ganzheitliche politische Rahmenwerke: Letztendlich ist eine kreislauforientierte gebaute Umwelt eine Kombination aus vielen Teilen, wie z. B. Bildung, wirtschaftliche Anreize, rechtliche Genehmigungen und kulturelle Werte. Ein hypothetisches Szenario, auf das viele politische Rahmenwerke abzielen, könnte wie folgt aussehen: Ein Architekturstudent lernt in der Schule, wie man ein abfallfreies Gebäude entwirft, und macht sich mit den Werkzeugen der Wiederverwendung vertraut. Wenn sie mit der Praxis beginnen, unterstützen die Bauvorschriften ihren Ansatz, indem sie kreative Wiederverwendungslösungen zulassen.
Wenn sie ein Gebäude entwerfen, das zu 30 Prozent aus wiederverwerteten Materialien besteht, kann der Kunde Steuergutschriften oder Zuschüsse erhalten, und wenn das Projekt ausgeschrieben wird, unterstützen die Kriterien der öffentlichen Auftragsvergabe das Angebot. Während der Bauphase gibt es ein Netz von Materialbanken, die wiederverwertete Komponenten ebenso einfach liefern wie neue. Jahre später, wenn das Gebäude umgebaut werden soll, holt der nächste Architekt den digitalen Materialpass hervor und plant eine Renovierung, bei der 80 Prozent der Struktur wiederverwendet werden. Anstelle eines Abbruchteams wird ein Rückbauteam eingestellt, und alles, was dabei herauskommt, wird für weitere Projekte wiederverwendet. Das mag im Moment noch idealistisch klingen, aber in einigen Bereichen auf der ganzen Welt wird es bereits umgesetzt.
Das Brüsseler Regionalprogramm für eine Kreislaufwirtschaft sieht freiwillige Maßnahmen bis 2025, obligatorische Kreislaufpraktiken für öffentliche Projekte kurz danach und weitergehende Vorschriften bis 2030 vor. Auch die EU-Leitlinien für ein umweltfreundliches öffentliches Beschaffungswesen enthalten Kreislaufkriterien. Im Bereich der Bildung zeigt die Tatsache, dass es jetzt einen Doktortitel in „Circularity Architecture“ gibt (wie u. a. von der TU Delft und der NTNU Norwegen angekündigt), dass das Thema formalisiert wird.
Um die Grundsätze der Wiederverwendbarkeit in den Mainstream zu bringen, muss ein Ökosystem geschaffen werden, in dem dies belohnt wird und das einfach und zugänglich ist. Wenn ein Architekturstudent seinen Abschluss macht, weil er einen runden Pavillon gebaut hat, wenn ein Bauträger es profitabler findet, eine wiederverwendbare Fassade zu mieten, und wenn das Gesetz wiederverwendeten Stahl nicht mehr als verdächtig ansieht – dann wird sich wiederverwendbare Architektur wirklich durchsetzen. Und wir sind auf diesem Weg. Der Impuls von Vordenkern in Verbindung mit Innovationen an der Basis hat zu neuen Standards und Strategien geführt. Wie ein Leitfaden für die Kreislaufwirtschaft in Städten feststellt, geht es darum, von einzelnen Pionierprojekten zu einer weit verbreiteten Übernahme durch einen „Wandel auf Systemebene“ überzugehen. In den kommenden Jahren wird es wahrscheinlich zu einer rasanten Entwicklung kommen: mehr Städte schreiben Materialpässe vor, mehr Schulen unterrichten die Planung für den Abriss, und Ingenieurgesellschaften veröffentlichen Richtlinien für die Wiederverwendung von Bauteilen. Mit jedem Gebäude, das erfolgreich wiederverwendete Teile verwendet oder ohne Abfall abgebaut wird, schwindet die Skepsis und die Argumente für die Kreislaufarchitektur werden stärker.
Bei der Entwicklung hin zu einer wiederverwendbaren Architektur geht es ebenso sehr darum, Prozesse und Prioritäten zu überdenken, wie es um spezifische Techniken geht. Alle Beteiligten sind aufgefordert, ein Gebäude nicht nur als Endprodukt zu betrachten, sondern als eine vorübergehende Sammlung von Materialien, die für andere Zwecke verwendet werden können. Die Politik sorgt dafür, dass dies wirtschaftlich und rechtlich machbar ist, und die Vorschriften sorgen für technische Sicherheit und Standardisierung. Die Kombination dieser Bemühungen ist geeignet, die gebaute Umwelt von einem linearen „Bauen-Nutzen-Entsorgen“-Modell in ein zyklisches Modell umzuwandeln, bei dem Gebäude zu dynamischen Materialbanken werden und sich die Rolle des Architekten auf das generationsübergreifende Materialmanagement ausweitet.
Entdecke mehr von Dök Architektur
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.